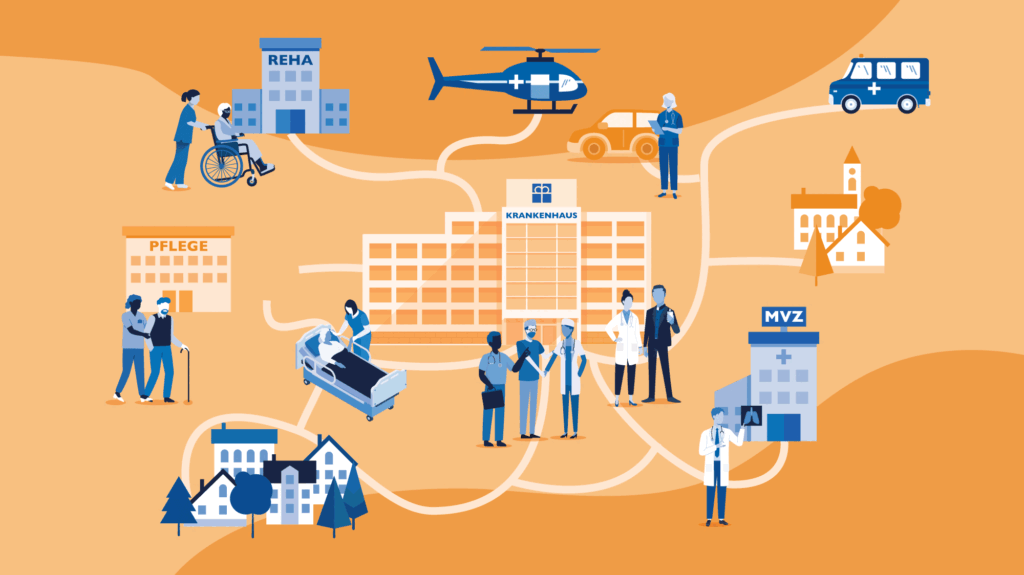Die Diakonie Deutschland, der Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe (BeB) und der Deutsche Evangelische Krankenhausverband (DEKV) nehmen gemeinsam die Gelegenheit wahr, zu dem oben benannten Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts vom 16.12.2021 umgesetzt werden, eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen im Falle einer pandemie-bedingten Triage zu verhindern. Dies erfolgt über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, in das ein neuer Paragraph 5c im Abschnitt 2 „Koordinierung und epidemische Lage von nationaler Tragweite“ ergänzt wird. Die vorgesehene Regelung beinhaltet sowohl materiell-rechtliche Vorgaben als auch Verfahrensregelungen für den Entscheidungsprozess. Diakonie Deutschland, BeB und DEKV unterstützen den aktuellen Gesetzgebungsprozess mit den Überlegungen, die in einem breiten Meinungsfindungsprozess innerhalb der diakonischen Gemeinschaft, der evangelischen Krankenhäuser sowie der Einrichtungen der Eingliederungshilfe entstanden sind. In letzter Konsequenz geht es nicht nur darum, den Zugang zu intensivmedizinischer Versorgung in der Pandemie sicherzustellen, sondern auch darum, ein inklusives und diskriminierungsfreies Gesundheitssystem in Deutschland auszugestalten. Wir danken daher für die Möglichkeit, zu diesem wichtigen Thema Stellung zu nehmen, und bitten nachdrücklich um Berücksichtigung der folgenden Überlegungen und Formulierungsvorschläge.
Zu § 5c, Absatz 2: Materiell-rechtliche Vorgaben
Der Gesetzentwurf macht deutlich, dass die Entscheidung über eine Zuteilung nicht ausreichender intensivmedizinischer Ressourcen nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patient:innen vorgenommen werden darf. Bestehende Komorbiditäten dürfen laut dem Gesetzentwurf in einer Zuteilungsentscheidung nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere und/oder Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Eine Einschätzung der Gebrechlichkeit von Patient:innen, wie sie in den DIVI-Empfehlungen aus dem Jahr 2020 vorgeschlagen wird, darf hingegen nicht in die Priorisierung einfließen. Auch das Alter, das Vorliegen einer Behinderung, die verbleibende Lebenserwartung und die vermeintliche Lebensqualität dürfen für eine Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nicht berücksichtigt werden. Diese Klarstellung und die Festlegung von Kriterien, die für die Zuteilungsentscheidung explizit nicht herangezogen werden dürfen, ist sehr positiv zu bewerten.
Wir begrüßen zudem den in dem Entwurf erkennbaren Willen, sich auf ein klares Entscheidungskriterium zu verständigen. Der Gesetzentwurf nimmt den Hinweis des Bundesverfassungsgerichts auf, nach dem eine Zuteilungsentscheidung anhand der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der Betroffenen verfassungsrechtlich unbedenklich ist. Mit der Festlegung auf das Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit folgt der Gesetzentwurf der Handlungsmaxime, mit den zur Verfügung stehenden knappen Ressourcen so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Zugleich nimmt er damit in Kauf, dass in einer Situation, in der nicht alle Menschen gleichermaßen berücksichtigt werden können, Menschen mit Behinderungen ebenso wie ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zumindest mittelbar aufgrund ihrer häufig schlechteren aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit weiterhin benachteiligt werden. Der Entwurf steht so mit dem Prinzip der Lebenswertindifferenz in einem gewissen Widerspruch. Der vom Bundesverfassungsgericht für die Entscheidungsfindung geforderte Ausschluss „subjektiver Momente“ wird mit dem Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nur schwer in wirksamer Weise gelingen. Zumindest eine gewisse Verbesserung könnte jedoch erzielt werden, wenn das Kriterium dahingehend weiter geschärft würde, dass der Unterschied in der auf die aktuelle Krankheit bezogenen kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit besonders erheblich sein muss, um eine Zuteilungsentscheidung zu rechtfertigen. Dadurch und in Verbindung mit einer auch in der Dokumentation spürbaren erhöhten Darlegungslast würden die Möglichkeiten einer unterbewussten Benachteiligung weiter reduziert. Dennoch bliebe das Abstellen auf die Überlebenswahrscheinlichkeit kein befriedigender Weg, sondern vielmehr eine unvollkommene Lösung in einem ethischen Dilemma, in dem wir als Gesellschaft nur die Möglichkeit haben, uns für das am wenigsten schlechte Verfahren zu entscheiden.
Formulierungsvorschlag:
§ 5c Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund eines besonders erheblichen Unterschieds in der auf die aktuelle Krankheit bezogenen kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patient:innen getroffen werden.“
Zu § 5c, Absatz 2: Patient:innenwille, Indikation und Dringlichkeit
Grundvoraussetzung einer Zuteilungsentscheidung anhand der auf die aktuelle Erkrankung bezogenen kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit, so ist der Gesetzesbegründung zu entnehmen, ist das Bestehen eines entsprechenden Patient:innenwillens sowie die Indikation für eine intensivmedizinische Behandlung. Eine weitere Grundvoraussetzung, die in den Erläuterungen der vorigen Gesetzentwürfen noch benannt wurde, sollte zudem die Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung sein. Nicht-zeitkritische intensivmedizinische Behandlungen, bei denen durch eine Verzögerung keine Verschlechterung der Prognose und keine irreversiblen Gesundheitsschädigungen zu erwarten sind, sollten aufgeschoben werden und die betroffenen Patient:innen nicht in die Zuteilungsentscheidung eingehen. Dies muss aus Gründen der Rechtsklarheit auch im Gesetzestest selbst klar formuliert werden. Der mündlich geäußerte, vorausverfügte oder mutmaßliche Patient:innenwille ist bei Eintritt der Intensivpflicht nochmals zu prüfen. Zur Ermittlung des Patient:innenwillens und zur Unterstützung der Kommunikation vor Ort sind, wenn dies aufgrund von Kommunikationsbarrieren notwendig ist, Angehörige, persönlich Begleitende oder Betreuende mit einzubeziehen. Information und Aufklärung über die intensiv-medizinische Behandlung müssen verständlich sein und Krankenhäuser müssen Möglichkeiten einer barrierearmen Kommunikation vorhalten, wie beispielsweise Informationsmaterialien in leichter Sprache und Kontaktdaten von Gebärdensprachdolmetschenden, die im Bedarfsfall zu kontaktieren sind. Die verlässliche Refinanzierung von Kommunikationsleistungen nach § 17 Abs.1 SGB I ist durch den Gesetzgeber sicherzustellen. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ist zu beauftragen, entsprechende Aufklärungsmaterialien in leichter Sprache zu entwickeln, damit diese den Krankenhäusern zur Verfügung stehen. Eine zentrale Erstellung gewährleistet, dass die Aufklärungsmaterialien evidenzbasiert und von Expert:innen für die Belange von Menschen mit Behinderungen qualitätsgesichert sind.
Formulierungsvorschlag:
Nach §5c, Absatz 2, werden folgende Ergänzungen eingefügt:
„Grundvoraussetzung für eine Zuteilungsentscheidung ist das Vorliegen eines die jeweilige intensivmedizinische Behandlung entsprechenden Patient:innenwillens, die Indikation für eine intensivmedizinische Behandlung sowie die vergleichbare Dringlichkeit der intensivmedizinischen Behandlung der betroffenen Patient:innen.“
„Für eine gesicherte Ermittlung des Patient:innenwillens bezüglich einer Intensivbehandlung haben Menschen mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit Anspruch auf Leistungen nach § 17 Absatz 1 SGB I.“
„Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) wird beauftragt, bis 31.07.2023 evidenzbasierte Handreichungen in leichter Sprache, die die Entscheidung für oder gegen intensivmedizinische Behandlungen unterstützen, zu entwickeln. Diese Handreichungen sind durch die Krankenhäuser vorzuhalten.“
Zu §5c, Absatz 2: Eine Ex-Post-Triage wird ausgeschlossen
Dass eine Ex-Post-Triage gesetzgeberisch untersagt werden soll, haben die Verbände mit großer Erleichterung aufgenommen. Eine Priorisierungsentscheidung darf nur zwischen Personen stattfinden, die vor einer Behandlung stehen, die Beendigung einer Behandlung im Rahmen einer Triage-Entscheidung hingegen ist nicht zulässig. Die Wegnahme eines Beatmungsgeräts im Rahmen einer bereits begonnenen Behandlung zugunsten eines neu hinzukommenden Patienten wäre weder zu rechtfertigen noch zu entschuldigen. Mit Aufnahme der Behandlung wird ein Prozess der Lebensrettung in Gang gesetzt, dessen Beendigung zum Zwecke der Rettung eines anderen Patienten als aktive rechtswidrige Tötung zu bewerten wäre, sofern der Behandlungsabbruch gegen den Willen der sich bereits in intensivmedizinischer Behandlung befindlichen Person erfolgt. Ein eindeutiges Verbot einer Ex-Post-Triage schließt selbstverständlich nicht aus, dass Patient:innen, bei denen eine Indikation für und/oder die Einwilligung in die intensiv-medizinische Behandlung nicht mehr gegeben ist, in eine palliative Behandlung überführt werden.
§5c, Absatz 3: Verfahrensregelungen für den Entscheidungsprozess
Der Gesetzentwurf besagt, dass im Falle einer Triage die Entscheidung nach dem Mehraugenprinzip durch zwei Fachärzt:innen erfolgen soll, die im Bereich Intensivmedizin praktizieren und hier über mehrjährige Erfahrung verfügen und die Patient:innen unabhängig voneinander begutachtet haben. Bei fehlendem Einvernehmen solle eine dritte gleichwertig qualifizierte Person miteinbezogen werden. Dieses Vorgehen erachten wir grundsätzlich als sinnvoll. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass auch ein:e Vertreter:in der Pflege mitberatend in die Entscheidung einbezogen wird. Pflegekräfte kennen Patient:innen aus der täglichen Versorgung und können wichtige Informationen zu deren Gesundheitszustand beitragen, die die medizinische Sicht sinnvoll ergänzen und unbewusste Diskriminierungen zu vermeiden helfen.
Wir sehen es dennoch als fraglich an, wie eine Begutachtung der Patient:innen durch zwei, ggf. sogar drei Fachärzt:innen, von denen nur eine Person in die unmittelbare Behandlung involviert sein darf, praktisch sichergestellt werden kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Vorgabe insbesondere in Zeiten pandemie-bedingt noch geringerer personeller Ressourcen in den Krankenhäusern nicht umzusetzen sein wird. Der Einsatz telemedizinischer Konsultationen ist ein guter Ansatzpunkt, aktuell steht jedoch die technische Infrastruktur hierfür nicht flächendeckend zur Verfügung.
Wenn Menschen mit Behinderungen oder Vorerkrankungen von der Zuteilungsentscheidung betroffen sind, muss nach dem Gesetzentwurf die Einschätzung einer weiteren hinzugezogenen Person mit entsprechender Fachexpertise für die Behinderung oder die Vorerkrankung bei der Zuteilungsentscheidung berücksichtigt werden. Dies ist grundsätzlich sehr zu begrüßen.
Formulierungsvorschlag:
In §5c, Absatz 3, werden folgende Ergänzungen eingefügt:
„Eine Pflegefachperson wird mitberatend in die Entscheidung einbezogen“.
§5c, Absatz 4: Dokumentation des Entscheidungsprozesses
Der Gesetzentwurf sieht eine umfassende Dokumentation des Entscheidungsprozesses, der für die Entscheidung maßgeblichen Umstände sowie der an der Entscheidung mitwirkenden Personen und ihrer Abstimmungen bzw. Stellungnahmen vor. Diese Vorgabe begrüßen wir ausdrücklich.
§5c, Absatz 5: Verfahrensanweisungen für den Entscheidungsprozess
Auch die im Gesetzentwurf enthaltene Verpflichtung der Krankenhäuser mit intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten, eine Verfahrensanweisung für den Fall einer Triage festzulegen, die ein Verfahren zur Benennung der an der Zuteilungsentscheidung mitwirkenden Ärzt:innen sowie ein Verfahren zur organisatorischen Umsetzung der Entscheidungsabläufe beinhaltet, und diese mindestens jährlich zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln, ist zu begrüßen.
Für die behandelnden Ärzt:innen und Pflegenden sind Triage-Situationen, in denen tragische Entscheidungen gefällt werden müssen, überaus belastend, und Krankenhäuser dürfen ihre Mitarbeitenden in solch schwierigen ethischen Dilemmata nicht allein lassen. Die Verfahrensanweisungen sollten daher auch Möglichkeiten beinhalten, die eine Aufbereitung des Erlebten erlauben – zum Beispiel durch Nachgespräche, Supervision und seelsorgerische Begleitung.
Weitere dringend erforderliche Schritte, um die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen im Falle einer pandemie-bedingten Triage zu verhindern
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass weitere Schritte dringend erforderlich sind, um eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen im Falle einer pandemie-bedingten Triage wirksam zu verhindern, auch über das hinaus, was im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes geregelt werden kann. Wir appellieren daher eindringlich an den Gesetzgeber, auch hier aktiv zu werden, u.a. im Rahmen des bereits im Koalitionsvertrag angekündigten Aktionsplanes für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen.
Vorgaben zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
So werden im Gesetzentwurf keine Vorgaben zu Aus-, Fort- und Weiterbildung gemacht, der Gesetzesbegründung ist jedoch zu entnehmen, dass die Approbationsordnung für Ärzt:innen zeitnah um Inhalte zu behinderungsspezifischen Besonderheiten ergänzt werden solle. Zudem solle gemeinsam mit der Bundesärztekammer darauf hingearbeitet werden, dass das Vorgehen im Falle einer pandemie-bedingten Triage verstärkt in Fort- und Weiterbildungen aufgenommen wird.
Die Stärkung der ärztlichen Ausbildung zu behinderungsspezifischen Inhalten ist eine Forderung, die von Behindertenverbänden seit langem erhoben wird. In den letzten Jahren sind einige Schritte in diese Richtung zu verzeichnen: So wurden im Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) des Medizinischen Fakultätentages, in den Gegenstandskatalogen für die ärztliche Prüfung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMMP), in der Musterweiterbildungsordnung Psychiatrie und Psychotherapie der Bundesärztekammer, in der Approbationsordnung für Psychotherapeut:innen und in der Musterweiterbildungsverordnung für Psychotherapeut:innen entsprechende Lerninhalte bereits verankert. Die vorgesehene Verankerung der Lerninhalte auch in der Approbationsordnung für Ärzt:innen ist daher dringend notwendig. Welche weiteren Präzisierungen in den vorgenannten Dokumenten notwendig sind, sollte mit den Gremien der Selbstverwaltung sowie mit Selbstvertreter:innen erörtert werden.
Zudem erweist sich aktuell die Umsetzung der bestehenden Vorgaben in den Aktivitäten der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung vielerorts als unzulänglich, sei es aufgrund eines Mangels an entsprechend erfahrenen und qualifizierten Lehrenden, aufgrund fehlender Priorisierung des Themas durch Hochschulen und Ausbildungsstätten oder aufgrund geringen Interesses der Ärztinnen und Ärzte. Wir sehen den Bund daher in der Verantwortung, darauf zu drängen, dass alle notwendigen Schritte zur Verbesserung der ärztlichen Aus- und Weiterbildung zeitnah und konsequent unternommen werden.
Auch die „Triage vor der Triage“ verhindern
In den zwei vergangenen Jahren der Pandemie ist es verschiedentlich dazu gekommen, dass Menschen, die in Pflegeeinrichtungen oder besonderen Wohnformen lebten, ohne Anschauung der einzelnen Person von einer Krankenhausaufnahme ausgeschlossen wurden, damit die knappen Ressourcen zur Behandlung von Patient:innen mit besserer Prognose zur Verfügung genutzt werden konnten. Eine solche „Triage vor der Triage“ ist nicht hinnehmbar und muss gesetzgeberisch untersagt werden. Ein diskriminierungsfreier Zugang zu intensivmedizinischer Behandlung erfordert zunächst, dass alle Menschen überhaupt bis dorthin vorgelassen werden.